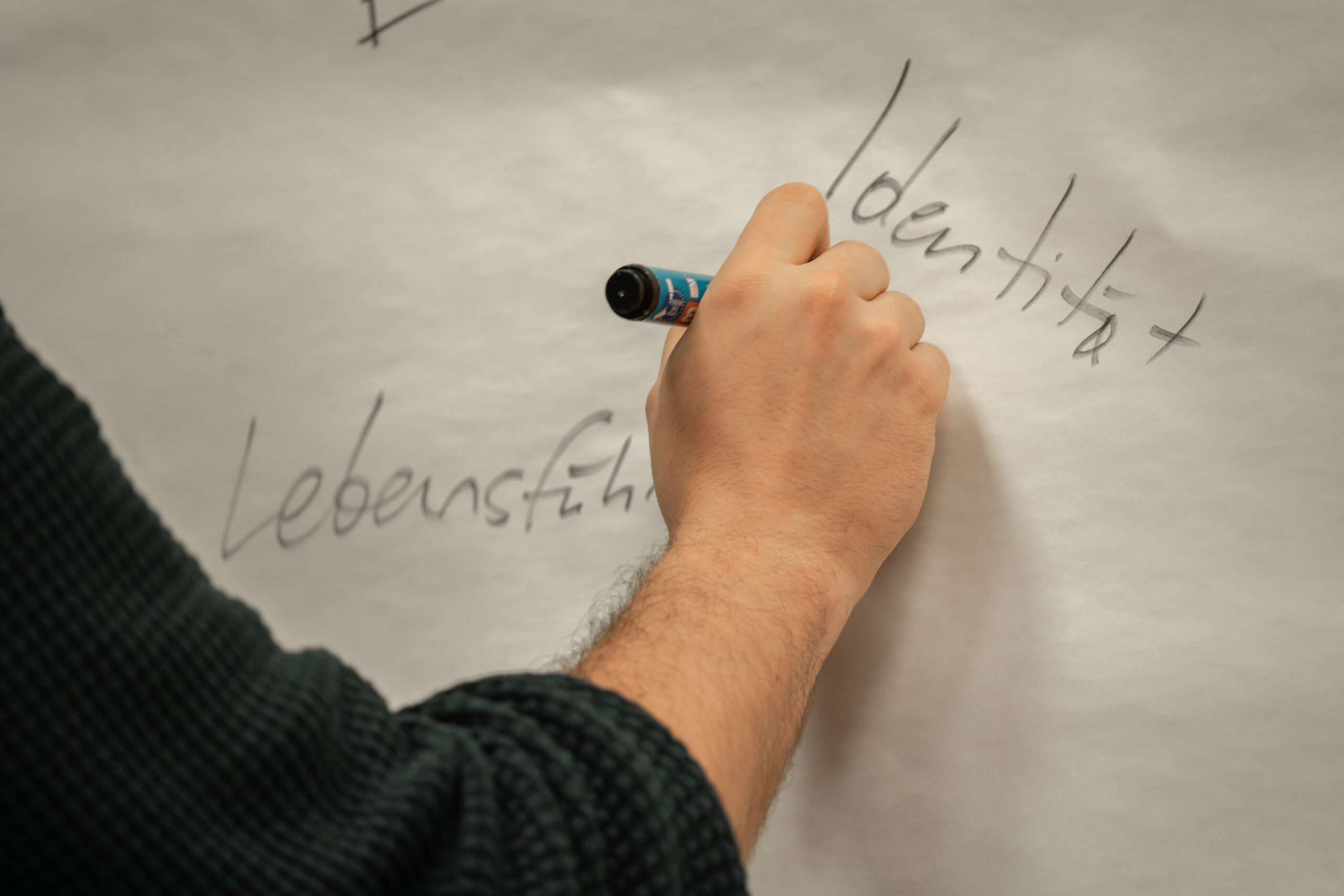Warum uns die Suche nach Identität krank macht.
Wer bin ich?
Es ist der 09. Juli 1944. Es tobt der Zweite Weltkrieg. Im Gefängnis Berlin-Tegel sitzt ein ehemaliger Pfarrer und Uni-Professor in Haft. Sein Name ist Dietrich Bonhoeffer. Er ist mutig für das, was er glaubt, aufgestanden. Immer wieder hatte er Fluchtmöglichkeiten. Doch er blieb. Er wollte seine Heimat nicht kampflos dem Nazi-Terror überlassen. Nun zeichnet sich immer mehr ab, dass sein Leben – wenn nicht ein Wunder passiert – dem Tod geweiht ist.
Doch Bonhoeffer quälen Zweifel. Hat er wirklich richtig gehandelt? Im Rückblick, im Wissen um den Sieg der Alliierten und die Verbrechen dieses Regimes, ist es leicht, ein Urteil zu sprechen. Doch diesen Luxus hat er nicht. Sein Leben steht auf dem Spiel. Er sieht sich mit dem Vorwurf, ein unpatriotischer religiöser Fanatiker zu sein, konfrontiert. Alleine in seiner Zelle schreibt er seine Fragen und Zweifel auf und formt sie in ein Gedicht:
Wer bin ich? Sie sagen mir oft,
ich träte aus meiner Zelle
gelassen und heiter und fest,
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß
Wer bin ich?
Sie sagen mir oft,
ich spräche mit meinen Bewachern
frei und freundlich und klar,
als hätte ich zu gebieten.
Wer bin ich? Sie sagen mir auch,
ich trüge die Tage des Unglücks
gleichmütig, lächelnd und stolz,
wie einer, der Siegen gewohnt ist.
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?
unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,
umgetrieben vom Warten auf große Dinge,
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?
Wer bin ich? Der oder jener?
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer?
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler
und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!
(Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer Werke Band 8: Widerstand und Ergebung – Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, 1998, S. 513-514)
Glücklicherweise sind wir nicht in der gleichen Situation wie Dietrich Bonhoeffer. Und trotzdem denke ich, dass viele von uns seine Zweifel nachvollziehen können. Menschen haben Meinungen über uns, unsere Gefühle ziehen uns in unterschiedliche Richtungen. Wie kann man in diesem Wirrwarr erkennen, wer man wirklich ist?
Das Ende der Authentizität?!?
Hans-Georg Möller, Philosophieprofessor an der University of Macau, greift genau diese Frage in dem spannenden Buch You and Your Profile: Identity After Authenticity auf und legt dabei den Finger auf eine offene Frage: Gibt es überhaupt ein authentisches Selbst?
Möller beobachtet, dass die Idee des „Authentisch-Seins“ nicht immer selbstverständlich war. In traditionellen Gesellschaften haben Menschen verbindliche Rollen, aus denen sich durch die Religion, Tradition und die Gemeinschaft verbindliche Regeln ableiten. Solche verbindlichen Rollen geben klare Antworten auf die Frage: „Wer bin ich?“ Man hat nicht den Druck, sich selbst „erfinden“ zu müssen. Und gleichzeitig gibt es natürlich ein Problem: Warum sollte mir die Gesellschaft vorschreiben, wer ich bin und was meine Rolle ist?
Warum sollte ich etwa Bauer werden, nur weil mein Vater auch ein Bauer war?
In den Worten von Dietrich Bonhoeffer: Bin ich wirklich, was andere von mir sagen?
Im Mittelalter kommt dann die Idee der “Einzelheit” erstmals auf. Über die Reformation hin zur Aufklärung entwickelt sich daraus im christlichen Westen die Idee des Individualismus. Man wirft die Fesseln der Gesellschaft ab und findet sich selbst: “Let it go!”
Im Profundum-Interview Das Ende der Authentizität? offenbart Hans-Georg Möller daher: Die Idee vom authentischen Selbst ist ohne dem westlichen, christlichen Denkweise nicht denkbar! Weder für einen buddhistischen Thailänder noch für einen konfuzianischen Chinesen macht ein solcher Individualismus Sinn, während es im christlich geprägten Europa unzumutbar scheint, unauthentisch zu leben. Doch nun, schreibt Hans-Georg Möller in seinem Buch, wäre genau diese Idee der Authentizität am Ende und ein neuer Weg uns selbst in dieser Welt zu verstehen ist da: Das Profil!
Social Media und die Obsession mit Profilen zu kritisieren, ist eine gewisse Mode:
Facebook, Instagram, TikTok und Co. sind ja alle so unauthentisch! Aber genau hier hakt das Buch ein:
Macht es Social Media nicht für uns alle möglich, dass wir uns profilieren können? Etwas, was bis jetzt nur den großen Markenunternehmen vorenthalten war.
Und ist das Sich-Profilieren nicht ein Ausgleich zu dem Individualismus der Authentizität, weil der Mensch nicht losgelöst von seinen Mitmenschen leben kann?
Das Authentizitäts-Paradox
Hans-Georg Möller hat deswegen keine Nostalgie für die angeblich guten, alten Zeiten, als Menschen ohne Social Media angeblich noch authentisch waren. Diesen Gedanken findet er absurd, weil Authentizität sich selbst widerspricht:
Wenn erwartet wird, dass man authentisch sein soll, dann ist dieses Streben nach Originalität nicht originell, sondern von anderen gelernt, von denen man als authentisch anerkannt werden möchte.
Das Streben nach Authentizität ist damit ein sich-profilierender Teufelskreis, bei dem wir uns ständig neu erfinden müssen. Dadurch, dass man erkennbar authentisch sein möchte und soll, vereinheitlicht sich die Authentizität, was sie wiederum unoriginell macht.
Dadurch versteht man auch den Drang auf Plattformen wie TikTok, sich durch immer extremere Stunts und Trends immer neu zu profilieren: Umso mehr Menschen danach streben authentisch zu sein, desto weniger authentisch sind sie.
Genuine Pretending, Pharisäer und Liturgie
Das heißt nicht, dass Hans-Georg Möller die Probleme unserer sich ständig profilierenden Social Media Kultur nicht sieht. Die Gefahr, dass man in dem Versuch, sich selbst zu profilieren „sich selbst“ verliert, ist natürlich real und birgt viele negative Konsequenzen für anti-soziales Verhalten, wie man bei vielen Social Media Trends sehen kann. Aber statt Menschen dafür zu beschämen, dass sie unauthentisch sind (was Menschen in ein nicht lebbares Paradox treiben würde) hat der daoistische Philosoph Hans-Georg Möller einen anderen Vorschlag, Genuine Pretending: also aufrichtig so zu tun als ob.
Was bedeutet es, aufrichtig so zu tun als ob?
Einerseits heißt es, dass man sich von dem Authentizitäts- und Profilierungsdruck löst, weil man die Frage “Wer bin ich und als wer werde ich gesehen?” weniger ernst nimmt.
Man hinterfragt: Wer will ich denn sein und wessen Meinung ist für mich wirklich von Bedeutung.
Andererseits heißt es auch sich bewusst zu machen, dass wir alle eigentlich ständig nur so tun, als ob. Niemand ist jemals wirklich authentisch, weil uns immer wichtig ist, wie wir von anderen gesehen werden. Hier ist wieder etwas Paradoxes: Wenn mir egal ist, wie mich der andere sieht und ich mich entsprechend verhalte, dann ist es mir ja wichtig, dass der andere erkennt, dass seine Meinung mir egal ist.
Allerdings ist das kein reines “so tun als ob”, keine blinde Profilierungswut. Wichtig ist, dass es genuin, also aufrichtig und echt ist. Hier könnte man sagen, dass der christliche Vorwurf der Scheinheiligkeit hereinkommt.
Das ist der Vorwurf, den Jesus an die Pharisäer macht:
Nicht, dass sie aufrichtig „so tun, als ob“ und dann an ihrem eigenen Standard scheitern,
sondern, dass sie nur so tun, als ob sie aufrichtig wären.
Im christlichen Glauben gibt es aber auch ein positives so tun, als ob, nämlich die Liturgie, also das gemeinsame, gottesdienstliche Beten und Bekennen des Glaubens, dass mich trägt, selbst wenn ich diese Gebete und Bekenntnisse nicht authentisch fühlen kann.
Identität als Gottes Geschenk an uns
Deswegen sind die Fragen, die durch das Ende der Authentizität aufgeworfen werden, spannend für uns als Christen durchzudenken – und eine Gelegenheit sich auf den Reichtum der Schätze der christlichen Vergangenheit zu besinnen:
Wenn die moderne Lobpreiskultur Christen Druck macht, weil sie einfordert, dass wir authentisch vor Gott so kommen sollen wie wir sind, dann stehen wir Menschen in einem unlösbaren Widerspruch:
Bin ich überhaupt, wer ich in der Gemeinde oder im Lobpreis vorgebe, dass ich bin?
Wie schon Bonhoeffer erkannt hat, führt das dazu, dass wir weniger wir selbst sind, weil wir nun bewusst dunkle Seiten von uns selbst anfangen vor den anderen (und vielleicht auch vor Gott) zu verstecken. Außerdem schafft es einen inneren Widerspruch: Was, wenn ich die Wahrheiten, die ich aussinge, nicht authentisch fühle? Bin ich dann überhaupt wirklich ein Christ?
Christlicher Glaube sucht seine Identität aber nicht in authentischen Gefühlen in mir selbst. Er bekommt sie als Geschenk von außen durch Gott zugesprochen.
Bonhoeffer sagt in einer Vorlesung 1933:
“Die Frage nach dem ‘Wer’ ist die Frage nach der Transzendenz.”
Wenn wir in uns und um uns nach Antworten suchen, dann werden wir immer daran krank werden, weil weder die Gesellschaft noch wir in uns selbst die Antwort tragen. Für die Antwort müssen wir über die Welt hinausschauen, denn in der Geschichte der Bibel sieht man:
Identität ist immer etwas, was Gott zuspricht und schenkt, nicht etwas, was man in sich trägt.
In der theologischen Sprache von Martin Luther: Der Mensch ist gleichzeitig Gerechtfertigter und Sünder. Sünder aufgrund seiner Natur, gerechtfertigtes Kind Gottes, weil Gott ihm das durch das Evangelium zugesprochen hat. Aber das finde ich nicht in dieser Welt und weniger noch in mir selbst, sondern nur bei Gott. Wie Bonhoeffer am Ende seines Gedichtes schreibt:
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!